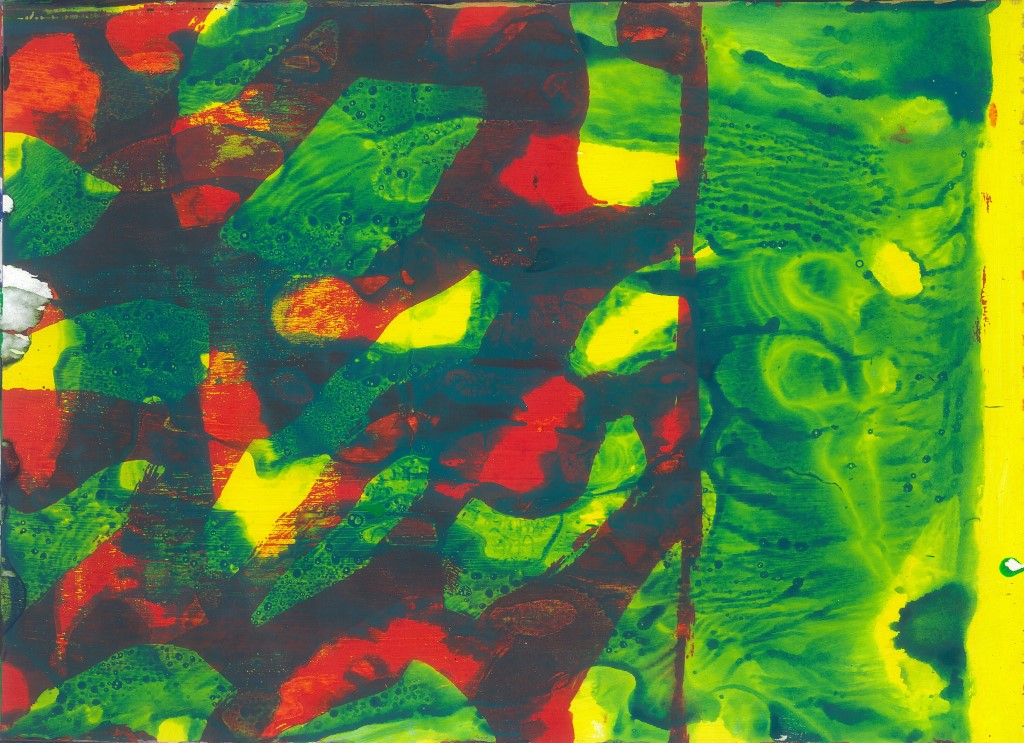„Lampedusa in Hamburg“, eine Gruppe von
Geflüchteten, die nach dem Libyen-Krieg über Italien nach Hamburg kamen und
seit vielen Jahren eine Anerkennung als asylberechtigtes Kollektiv einfordern,
hat 2013 das Lampedusa-Zelt als zentralen Austauschort für Geflüchtete
errichtet. Im März 2020 wurde das als Dauermahnwache angemeldete Zelt zum „Infektionsschutz“
von der Polizei geräumt, obwohl die Veranstalter Corona-Auflagen eingehalten
haben. Nun befürchten sie, dass das Zelt auch nach der Pandemie nicht mehr an
dem zentralen Ort aufgestellt werden darf. [Anmerkung Anke Schwarzer]
 Anke Schwarzer RESIZED(1)_1631023052401.jpg)
© Anke Schwarzer
Rubina Ahmadi
„Man vergisst häufig, dass die Migration nach Hamburg auch mit dem Kolonialismus verknüpft war und ist.“
Interview: Anke Schwarzer, 2021
Welche Orte
und Räume in Hamburg kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die koloniale
Geschichte und Gegenwart denken?
Bei dieser Frage ist natürlich der Hamburger Hafen ein zentrales Thema. Aber wenn ich an die koloniale Gegenwart denke, fallen mir auch sofort die Menschen und das Leben rund um den Steindamm im Stadtteil St. Georg ein. Dort gibt es einen Mix von indischen Läden, pakistanischen, indonesischen Geschäften und arabischen Supermärkten. Vielleicht gibt es nicht den direkten, klassischen Bezug zu Hamburg und seiner Kolonialgeschichte, aber – aus einer europäischen Perspektive betrachtet – ist der Ort trotzdem sehr spannend. Es gibt Verbindungen zu den britischen Kolonien wie Indien und Pakistan oder auch Syrien, wenn es um Frankreich geht. Es gibt dort viele Bezüge zum Thema Kolonialismus zu entdecken: Die Menschen, die dort arbeiten oder einen Laden betreiben, haben selbst eine direkte Erfahrung mit Kolonialismus oder kennen ihn aus dem Kontext ihrer Familiengeschichte.
Wenn man am Hauptbahnhof aussteigt und nicht in die Einkaufsmeile mit den teuren Luxusmarken rund um die Mönckebergstraße und den Jungfernstieg, sondern in die andere Richtung zum Steindamm läuft, sieht man Schriftzüge in verschiedenen Sprachen. Es ist Hamburg, aber gleichzeitig ist es auch nicht Hamburg. Die Verbindungslinie vom Steindamm mit seinen bunten und einfachen Läden über die Fußgängerzone Spitalerstraße bis zum Jungfernstieg lässt sich als eine Reise zwischen „Orient und Okzident“ beschreiben. Am Steindamm finden wir Schilder mit arabischen und indischen Schriften. Er ist immer noch anders als andere Gegenden. Ich finde die Straße einen interessanten Ort, den aber viele Hamburger und Touristen entweder überhaupt nicht oder nur als Schmuddelecke wahrnehmen. Sie gehen dort nicht hin, weil sie dort nichts suchen und weil sie ihn als fremd empfinden. Andererseits kenne ich auch Leute, die sagen: „Wenn ich einen Kurzurlaub brauche, dann fahre ich zum Steindamm.“
Jeder Supermarkt hat eine Geschichte für sich. Und die Menschen dort, die damals nach Deutschland eingewandert sind und heute einen Laden haben, oder auch die, die heute als Geflüchtete oder Studenten kommen, haben mit Kolonialismus zu tun.
Man vergisst häufig, dass die Migration nach Deutschland und nach Hamburg vor über 50, 60 Jahren auch mit dem Kolonialismus verknüpft war und man konzentriert sich vor allem auf türkische Migranten. Die migrantischen Communities sind aber bunter und vielfältiger! Kolonisierte Länder haben sich vom britischen und französischen „Mutterland“ gelöst. Die Gründe für die Menschen, die nach Europa gekommen sind und auch nach Hamburg, sind auch in den Kriegen und Konflikten zu suchen, die es damals aufgrund der Unabhängigkeitsbewegungen gab. Der Hafen spielt ebenfalls eine Rolle: Durch den Handel kamen Menschen nach Hamburg, einige von ihnen aber auch, weil sie aus dem ehemals kolonisierten Land flüchten mussten und dort keine Perspektive mehr sahen.
Diese Gründe und auch den Zerfall von Herkunftsstaaten sieht man auch heute bei den Migrationsbewegungen aus Nordafrika, Syrien und anderen Ländern des Nahen Ostens. Auch in diesen Herkunftsländern lassen sich Spuren damaliger geopolitischer Gegebenheiten ausmachen, die sich immer noch auf die Gegenwart auswirken. Und diese sind am Steindamm sehr dicht versammelt: die Menschen, die Geschäfte oder die Moscheen für verschiedene Gemeinden.
Sichtbarmachen ist wichtig. Dafür sollten wir aber einen Schritt zurückgehen. Vermutlich sind sich viele Menschen rund um den Steindamm der Verbindung zum Kolonialismus gar nicht bewusst. Ich glaube, viele Leute, die dort sind, sehen sich häufig noch als Fremde und nicht als Hamburger mit einer kolonialen Erfahrung. Meine Vermutung ist, dass die Generation, die Händler und Geschäftsleute, die damals gekommen sind und heute auf dem Steindamm Läden oder Restaurants betreiben, ihr Hiersein nicht wirklich mit den Folgen des Kolonialismus verbinden und sich ihrer eigenen persönlichen Geschichte nicht so sehr bewusst sind. Diese Bezüge müssten die Menschen vor Ort selber sichtbar machen. Es ist ihre Geschichte. Es sind Erfahrungen, die nicht in der Heimat geblieben sind, sondern die sie mitgenommen haben. Dadurch dass sie sich aber immer noch als Fremde sehen, identifizieren sie sich auch kaum mit diesem Thema. „Es ist eine Geschichte der Heimat und das Thema und meine Erfahrung damit hat hier in Hamburg nichts zu suchen, weil ich fremd bin“, so denken vermutlich viele aus der älteren Generation.
Die, die damals gekommen sind, sehen sich nicht unbedingt als Geflüchtete. Das ist heute anders: Die Menschen, die jetzt kommen, können eher den Bezug zum Kolonialismus herstellen. Viele sind vor Krieg geflohen. Bei denen, die in den letzten Jahren gekommen sind, sehen wir alte geopolitische Problemlagen, die es schon länger gab, die sich jetzt aber verschärft haben.
Die Straßen rund um den Steindamm bieten eine wichtige Infrastruktur. Für viele nicht-europäische Ankommende ist dies der Ort, wo sie den ersten Schritt machen können. Es ist ein zentraler Ort in Hamburg, wo ich immer jemanden mit meiner Herkunftssprache finde, der mir weiterhelfen kann. Es gibt Telefonläden, Büros für Geldtransfer und Bestattungswesen. Bis vor Kurzem gab es das Lampedusa-Zelt, das ein zentraler Ort für Neuankommende war.
Lampedusa-Zelt
Die jüngere Generation sieht, dass die Eltern gekommen und geblieben sind. Und dass sie selber auch nicht mehr gehen, sondern in der Stadt bleiben werden. Es gibt bei den Jüngeren die Tendenz, sich stärker mit Hamburg zu identifizieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das auch stärker nach außen tragen und dass sie sich trauen, die Themen rund um die kolonialen Erfahrungen ihrer Vorfahren in die Öffentlichkeit zu bringen. Die junge Generation sieht sich nicht mehr als Gast wie noch viele Ältere, die dachten, dass sie keine Rechte hätten, sich sichtbar zu machen – und für die es vielleicht auch häufig besser war, unsichtbar zu bleiben. Das wird sich mit der neuen Generation ändern, die selbstbewusster auftreten wird. Vielleicht sehen wir das auch im Straßenbild. Es gibt verschiedene politische Initiativen im Stadtteil, Aktionen und Bildungsarbeit. Vielleicht wird es auch Schilder oder Informationstafeln zu bestimmten Themen geben, denn für die jüngere Generation ist Deutsch mittlerweile die Alltagssprache. Das Straßenbild wird sich sicher ändern; man muss schauen, wie sich das Viertel mit den teuren Hotels und Wohnungen in den nächsten Jahren weiterentwickelt.